Gewerkschaften fordern zu viel Solidarität

Damit Sie mich nicht falsch verstehen – ich finde Solidarität eine gute Sache. Damit meine ich, dass in der Schweiz alle eine faire Chance haben sollen, eine gute Ausbildung zu geniessen. Damit meine ich sogar auch, dass niemand aufgrund seiner Herkunft, seiner Rasse, seinem Geschlecht oder Familienstand benachteiligt oder bevorteilt werden soll. Ich denke da stimmen Sie mir zu.
Kontroverser wird es dann aber, wenn man sich die Forderungen nach mehr Solidarität durch die Gewerkschaften sowie von Personen anhört, die sich benachteiligt fühlen.
So beklagt der Schweizerische Gewerkschaftsbund, dass die „Schere zwischen arm und reich immer“ grösser wird. Ich habe mir die Daten ihrer Studie – zeitlich passend zum 1. Mai in die Presse gestreut – nicht im Detail angeschaut. Aber ich würde sagen den meisten Menschen, die gesund sind, geht es in der Schweiz gut. Nicht umsonst führt die Schweiz regelmässig bei Umfragen zur Lebensqualität und zur Zufriedenheit mit dem eigenen Leben.
Das Problem ist vielmehr, dass sich Menschen mit anderen Menschen vergleichen. Und hier kommt es darauf an, mit wem man sich vergleicht.
Wenn Sie sich mit dem reichsten Einwohner in Ihrer Gemeinde vergleichen, dann sind Sie arm. Er wird ein grosses Haus haben, Sie vielleicht nur eine Mietwohnung. Er wird drei teure, neue Autos besitzen, Sie nur ein älteres Fahrzeug. Er kann sich Ferien auf den Malediven leisten, bei Ihnen reicht es nur für die Costa Brava.
Aber stellen Sie einen anderen Vergleich an. Vergleichen Sie sich mit dem ärmsten Einwohner Ihrer Gemeinde. So gesehen sind Sie relativ reich und haben eigentlich alles, was Sie zum Leben benötigen.
Oder vergleichen Sie sich mit einer Person, die nicht in einem der westlichen Länder wohnt. Für Afrikaner leben Europäer alle im Luxus.
Oder vergleichen Sie sich mit Ihren Vorfahren. Wussten Sie, dass es erst 160 Jahre her ist, als Schweizer – durch Hunger und Arbeitslosigkeit getrieben – nach Amerika auswanderten? Heute muss niemand mehr mit hungrigem Magen ins Bett und darum bangen, wo er am nächsten Tag ein paar Franken zum Leben hernimmt. So gesehen geht es hier allen sehr gut.
Ich habe deswegen Mühe mit Initiativen, die mehr Umverteilung fordern. Denn Umverteilung bedeutet ja, dass man einer Personengruppe etwas wegnimmt, um es der anderen zu geben. Das geschieht in der Schweiz in erster Linie in Form von Steuern. Gut verdienende Personen zahlen drei bis fünf Monatslöhne an Steuern und Sozialabgaben. Schlecht verdienende Personen jammern zwar auch über die „hohen“ Steuern, bezahlen aber in Prozenten gerechnet viel weniger Abgaben – ganz zu schweigen von den absoluten Beträgen.
Ich finde es auch nicht richtig, wenn Reiche sich dank Steuertricks aus der Solidarität ziehen. Auch die Pauschalbesteuerung für reiche Ausländer gehört abgeschafft. Und die jüngste Unternehmenssteuerreform ist ein Skandal. In der Privatwirtschaft wären die Personen, welche deie Auswirkungen einer solchen Vorlage dermassen falsch berechnet haben, längst entlassen worden.
Aber was nicht sein darf ist, dass Personen, die überdurchschnittlich viel leisten und dafür entsprechend entlohnt werden, noch stärker zur Kasse gebeten werden sollen. Ich spreche hier nicht von den paar CEOs Novartis und UBS & Co., sondern von den Empfängern von Löhnen im oberen Drittel in der Schweiz.
Weil wir dürfen eines nicht vergessen: Arbeit muss sich finanziell lohnen. Wenn bei einer Lohnerhöhung 50% des Mehrverdienstes gleich wieder verschwinden, dann denkt sich manch einer: Ich arbeite lieber weniger. Denn mit einem 80%-Pensum habe ich netto immer noch 90% meines vorherigen Lohnes.
Und ich habe auch ein Problem mit der fehlenden Transparenz der Umverteilung in der Schweiz. Meiner Meinung nach müsste alles nur über die Steuern umverteilt werden. Wer wenig verdient, zahlt keine oder vielleicht 10% Steuern, wer sehr viel verdient, zahlt halt 35% oder auch 40% Steuern. Damit soll es sich dann aber haben. Mit dem steigenden Wohlstand in der Schweiz ist aber ein regelrechter Dschungel an Umverteilungen entstanden. So erhalten viele Schweizer Krankenkassenprämien-Vergünstigungen durch den Staat. Und wer bezahlt das? Die Steuerzahler – also primär die Gutverdiener. Oder ein Krippenplatz in der Kindertagesstätte – auch der wird einkommensabhängig bezahlt. Und jetzt kommt der SGB und fordert auch noch einkommensabhängige Krankenkassenprämien. Hier hört es dann mit der Solidarität auf. Es kann nicht sein, dass Gutverdienende einen gewichtigen Teil ihres Einkommens dem Staat abliefern müssen, um dann der Rest ihrer Lebenshaltungskosten auch noch einkommensabhängig zu bezahlen. Eine solche Solidarität ist der falsche Weg – so lohnt sich das harte Arbeiten nicht mehr.
Und solche Forderungen sind ein Fass ohne Boden. Warum sollen ausgerechnet die Krakenkassenprämien einkommensabhängig erhoben werden? Wie sieht es dann mit dem Preis für ein Auto aus? Soll der Autohändler – staatlich verordnet – auch die Preise abhängig vom Einkommen festlegen? Oder soll der Bankdirektor im Migros mehr fürs Brot bezahlen als seine Sekretärin?
 | 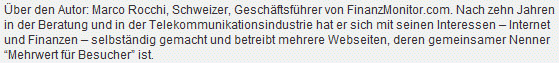 |
Auch interessant:
Was ist Ihre Meinung, Ihr Tipp oder Ihre Frage dazu? Antworten abbrechen
Aktuell: Vergleichen und Geld sparen
Zitat zum Thema Geld
FinanzZitat von FinanzMonitor.com.



